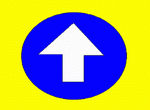| Inhalt
der Seite
1. FÜR WELCHE INDIKATIONEN IST EINE LITHIUMBEHANDLUNG ANGEZEIGT? |
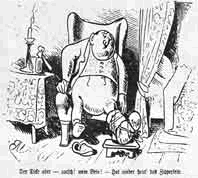
|
|
| 12. Weitere
LINKS und INFORMATIONEN z.B.
Lithium Aufklärung vor Ersteinnahme
Eine gute Einnahmezuverlässigkeit ist zu erreichen, wenn der Patient weiß, warum ein enger Kontakt zum Arzt notwendig und eine regelmäßige Tabletteneinnahme unabdingbar ist, warum der Lithiumspiegel und die Nieren- und Schilddrüsenwerte kontrolliert werden müssen und welche Auswirkungen die Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und Erkrankungen eventuell haben können. Spezialfälle wie die Vermeidung einer ungewollten Schwangerschaft und das Vorgehen bei notwendigen Narkosen werden am Schluss besprochen. Auch die Familienangehörigen sollten in jedem Falle über die Voraussetzungen einer erfolgreichen und sicheren Rezidivprophylaxe unterrichtet werden.
Hauptanwendungsgebiet für Lithium ist die manisch-depressive („bipolare“) Erkrankung. Es kann aber auch angewandt werden bei
Therapieresistenz bei sog. unipolaren Depressionen. Bei Bipolarstörungen,
sind die Phasenstabilisierer alleine
wirksamer als die Kombination mit Lithium
mit Antidepressiva. Neu ist die Erkenntnis dass LIthiumeingestellte Patienten einen besseren Verlauf bei SARS- Covid 19 Infektionen haben, und sich weniger anstecken. Ursache scheint die Wirsamkeit der Lithiumtherapie auf Zellkernebene zu sein:. Lithium hemmt die Glycogen Synthetase Kinase 3 ( GSK-3), die auch für die Phophorylierung und Produktion des Nucleocapsid Proteins des Covid 2 Virus von den Viren benutzt wird. Hierdurch erklärt sich eine um 30 % reduzierte Virusreplikation im Körper. ( Quelle: Beim Klein Levine Syndrom, einer atypischen Depression mit Heisshunger und Gewichtszunahme wirkt Lithium ebenfalls. Die Hauptursache , dass Lithium
abgesetzt wird besteht nicht im Auftreten von Nebenwirkungen
oder Komplikationen sondern, darin, dass der Patient/die
Patientin die Notwendigkeit hierfür nicht einsieht..
Plötzliches Absetzen von Lithium ist sehr ungünstig,
Lithium muss immer langsam in der Dosis vermindert werden (pro
Vierteljahr eine halbe Tbl.), sonst drohen durch das Absetzen
induzierte erneute Krankheitsphasen. Die frühere
Vermutung, dass die dann folgenden
Rückfälle schlechter auf Lithium ansprechen als bei der ersten
Lithiumeinstellung haben sich nicht
bestätigt).
Die Wirkung der Lithiumbehandlung hängt eng mit der Lithiumkonzentration im Blutserum zusammen. Lithium wird meist als Salz der Kohlensäure (Carbonat
) in einer Retardform morgens und abends eingenommen. Es gibt aber auch Untersuchungen, dass eine Einmalgabe abends
vor dem Schlafen gehen gleich wirksam und nebenwirkungsärmer ist. Die Langzeitnebenwirkungen sind bei Dosierungen im unteren Wirkspiegelbereich geringer als bei hoch dosierter Einstellung. Lithium soll eher zurückhaltend eingesetzt werden bei Erkrankungen die mit einer Gefährdung der Niere einhergehen: Diabetes und diabetische Nephropathie (Nierenschädigung), schwere Gicht, Arteriosklerose mit Nierenbeteiligung. Vorsicht ist auch geboten bei Myasthenia gravis, Addison Erkrankung, Morbus Parkinson, Psoriasis vulgaris, Hypothyreosen, und akuten Herzerkrankungen, die eine kochsalzarme Diät erfordern. Empfohlen werden wegen evtl. erhöhter
Krampfbereitschaft gelegentliche EEG Kontrollen,
insbesondere bei Kombination mit hochpotenten Neuroleptika.
Empfohlen werden auch Blutzucker- Kontrollen.
Wichtig ist es auch, keine Kalorienhaltige gezuckerte
Getränke zu sich zu nehmen, weil Lithium sonst eine stärkere
Gewichtszunahme bedingen kann. Herzkranke ältere Patienten werden in der Regel deshalb nicht oder nur sehr niedrigdosiert mit Lithium behandelt. LABORKONTROLLEN:
Am Tage vor der Blutentnahme sollte der Patient die letzte Tablette
wie immer zum Beispiel abends
einnehmen und dann morgens ohne Tbl. (Beispiel: letzte Tabletteneinnahme 21 Uhr, Blutprobe 9 Uhr).
Oder letzte Tabletteneinnahme 6 Uhr, Blutprobe 18 Uhr)
Ein Abfall der Lithiumspiegel kann durch gleichzeitige Einnahme von Medikamenten ausgelöst werden, die die Lithiumausscheidung erhöhen: z.B. entwässernde Medikamente "Schleifendiuretika" wie z.B. Furosemid, Torasemid oder Arelix ) Einen ähnlichen Effekt kann Kochsalz haben .. Es ist deshalb wichtig auf gleichmäßige Zufuhr von Kochsalz zu achten: . Vorischt: kochsalzarme Diät erhöht wegen einer Wechselwirkung an den Nieren den Lithiumspiegel und läßt die Werte erheblich ansteigen. Also : vorsichtig
sein bei Diäten, auch in Kurkliniken, bitte die Ärztedort
ausdrücklich auf die Lithiumtherapie hinweisen.!! Wichtig: leider erhöhen auch gängige
Schmerzmittel für Gelenkschmerzen wie Diclofenac, Voltaren
, Indometacin, Phenylbutazon und andere ("nonsteroidale")
Antirheumatica den Lithiumspiegel. Bestimmte Antibiotika (
Erythromycin und andere Makrolid Antibiotika erhöhen den
Lithiumspiegel). Es ist deshalb sinnvoll, bei einer Therapie mit Lithium Medikamentenwechselwirkungen im Beipackzettel nachzuschauen und ggf. den Lithiumspiegel kurzfristiger nochmals zu kontrollieren, wenn eine Änderung anderer Medikamente erfolgt ist.
Lithium wird über die Nieren ausgeschieden.. Es ist deshalb wichtig
,die Nierenfunktion vor und während der Lithiumeinnahme
zu kontrollieren.
NEBENSchilddrüsenVeränderungen durch Lithium: (CALCIUMSTOFFWECHSEL) Lithium verstärkt die Parathormon-Sekretion und vermindert die Calciumausscheidung über die Nieren, dadurch kommt es zu Hyperkalzämie und Hypokalzurie, einige Patienten weisen erhöhte Parathormon-Spiegel auf. Nach Absetzen des Lithiums kann sich die Hyperkalzämie normalisieren, nach längerer (über 10 Jahre) dauernder Behandlung mit Lithium ist eine Normalisierung der Calcium-Spiegel nach Beendigung der Therapie weniger wahrscheinlich. (Sekundärer Hyperparathyreoidismus) Thiaziddiuretika vermindern die Calciumausscheidung über die Nieren und führen zu einer milden Hyperkalzämie. Thiaziddiuretika sollen wegen gleichzeitigem Lithiumspiegelanstieg gemieden werden. Bei Patienten mit mildem Hyperparathyreoidismus können Thiaziddiuretika die Grunderkrankung demaskieren, in dem sie zu einem deutlichen Calcium-Anstieg im Serum führen. Fällt ein erhöhter Calcium-Spiegel nach Absetzen von Thiaziddiuretika nicht ab, spricht dies für das Vorliegen eines primären Hyperparathyreoidismus.
- N E I N - JA,
ABER mit
Einschränkungen - Für Frauen im gebärfähigen Alter ist es
am besten, während der Lithium-Behandlung für Kontrazeption zu
sorgen und nicht schwanger zu werden.
Vor einer geplanten Schwangerschaft ist das Risiko eines
Rückfalls der (bipolaren) Erkrankung durch das Weglassen der Behandlung gegen
das Risiko einer der möglichen
Fruchtschädigung (teratogenes Risiko: insbesondere
Herzfehler) abzuwägen. Lithiumtherapie und SchwangerschaftNach Berichten über Fehlbildungen bei Neugeborenen nach Lithiumbehandlung der Mutter wurden die Lithiumsalze etwa ab 1970 als gefährliche Teratogene, d.h. Medikamente und Stoffe mit erhöhtem Missbildungsrisiko betrachtet. Speziell die bei Kindern nicht Lithium-behandelter Mütter sehr seltene Ebstein-Anomalie und andere angeborene Herzfehler traten nach Lithium -Exposition in der Frühschwangerschaft gehäuft auf und führten zu der Empfehlung, während einer Schwangerschaft keinesfalls Lithium zu verabreichen. In Dänemark wurde 1968 zur Feststellung des Risikos ein spezielles „Lithium-Baby-Register“ eingerichtet. Nach neueren Erhebungen dürften allerdings die teratogenen Effekte von Lithium seinerzeit überschätzt worden sein, zum Beispiel durch zu niedrig angesetzte Fehlbildungsraten in der übrigen Bevölkerung. Das relative Risiko für Fehlbildungen steigt zwar unter Lithiumtherapie etwa um den Faktor 5–10. Da jedoch akute manische Phasen oder Suizidalität bei Depressionen für das ungeborene Kind lebensbedrohlich sein können, gelten nunmehr folgende Empfehlungen für die Lithiumtherapie in der Schwangerschaft: [8]
In den ersten beiden
Lebenstagen ist das Neugeborene engmaschig zu überwachen,
insbesondere im Hinblick auf toxische Symptome. Toxische Effekte des Lithiums
können ferner zu perinatalen Komplikationen führen,
die als „Floppy-Infant-Syndrom“ mit muskulärer Hypotonie,
niedrigem Apgar-Score und
Unmittelbar vor dem Geburtstermin
sollte deshalb die Dosis reduziert
werden, um perinatale
Komplikationen Sollte aus zwingendem Grund die Entscheidung für eine Lithiumtherapie fallen, müßten die Lithiumspiegel an der unteren Grenze der Wirksamkeit gehalten werden. Falls es nach Absetzen von Lithium zu einer manischen Phase kommen sollte, müßte die Patientin rechtzeitig Neuroleptika bekommen, bevorzugt solche, die seit langem im Handel sind und von denen ein
fruchtschädigendes, teratogenes Risiko nicht bekannt ist. Lithium
in der Stillzeit
Empfehlung:
Bei genauer Beobachtung des Säuglings (Muskeltonus, Tremor, unwillkürliche
Bewegungen, Zyanose, Dehydratation) und möglichst niedriger mütterlicher
Lithiumdosis kann Stillen im Einzelfall erlaubt werden. Dabei
muss aber berücksichtigt werden, dass Säuglinge besonders
gefährdet sind zu dehydrieren (z. B. bei gleichzeitig
vorliegendem Fieber oder Trinkschwäche). Pharmakokinetik:
HWZ: 18-24 h (max 36 h), Neugeborene: 17,9 h; Proteinbindung: 0%; molare
Masse: 74; relative Dosis: 0-‹10% (30%); M/P-Quotient:
0,3-0,17; orale Bioverfügbarkeit: 100%. Im Serum gestillter Säuglinge
nach Absinken der unmittelbar postnatal hohen Werte ein
Drittel der mütterlichen Konzentrationen oder deutlich
niedriger.
Praxis Beier Fügel Startseite
Lithium als Monotherapie hat sich als wirksamer erwiesen als die Therapie mit anderen Wirkstoffen zusammen, so dass das potentielle Risiko für kumulative Nebenwirkungen durch eine Polytherapie reduziert wird (Hayes JF et al., Worid Psychiatry 2016; 15:53-58). In einer in Großbritannien von 1995 bis 2013 durchgeführten Studie wurde das Auftreten von Nebenwirkungen an Patienten mit bipolaren Störungen, die mit Lithium, Valproat, Olanzapin und Quetiapin behandelt wurden, untersucht. Lithium zeigte dabei zwar eine höhere Inzidenz von endokrinen und renalen Störungen, aber gleichzeitig die größte Wirksamkeit bei der Reduzierung des Selbstmordrisikos und die geringste Gewichtszunahme im Vergleich zu anderen Therapien (Hayes JF et al, PLoS Med 2016 Äug 2; 13(8):el002058). Die anhaltende Reduktion der Selbstmordgefahr wird auch noch durch eine weitere Studie bestätigt (Tondo L, Pharmacopsichyatry 2018 Apr 19). In den letzten Jahren haben sowohl in vivo- als auch in vitro-(-Reagenzglas-) Untersuchungen gezeigt, dass Lithium auf verschiedenen Ebenen eine neuroprotektive d.h. Nervenzell-schützende und wiederherstellend regenerative Aktivität besitzt. Eine Magnetresonanzuntersuchung bei Patienten mit bipolarer Störung zeigte ein vergrößertes Hippocampusvolumen bei Patienten, die seit mehr als 61 Monaten mit Lithium behandelt wurden, im Vergleich zu Patienten, die keine Lithiumtherapie erhielten (Zungs et al., TransI Psychiatry 2016; 6:1-7). In Übereinstimmung mit diesen Ergebnissen finden sich drei Studien in der Literatur, die ein geringeres Risiko für die Entwicklung einer Alzheimer-Demenz bei bipolaren Patienten nachweisen, denen Lithium über einen längeren Zeitraum verabreicht wurde, im Vergleich zu Patienten, die mit Antiepileptika, Antidepressiva und Neuroleptika behandelt wurden (Kessing LV et al., Arch Gen Psychiatry 2008; 65(11):1331-1335; Kessing LV et al.. Bipolar Disord 2010;12(1):87-94). In vitro (Reagenzglas)-Untersuchungen haben nachgewiesen, dass Lithium die Glykogensynthase-Kinase-3 (GSK-3) hemmt, ein Enzym, das mehrere Zellprozesse wie Apoptose, d.h. programmierten Zelltod, die Glykogensynthese, synaptische Plastizität (d.h. die Fähigkeit zur Neuverschaltung von Nervenzellen) und die Gentranskription vermindert. DieHemmung des Enzyms verbessert deshalb die Zellstrukturstabilität und fördert das neuronale Überleben der Nervenzellen. (Dell'Osso L et al., Neuropsychiatric Disease and Treatment 2016; 12:1687-1703). Darüber hinaus wirkt Lithium schützend vor glutamat-induzierter, NMDAR-vermittelter Exzitotoxizität (Hashimoto R et al., J Neurochem 2002;80(4):589-597), reduziert den oxidativen Stress und verbessert damit die Funktion der mitochondrialen Atmungskette (Quiroz JA et al., Neuropsychobiology 2010;62(1):50-60) (Shalbuyeva N et al. J Biol Chem 2007:282(25): 18057-18068). Vertiefende Erklärungen zur Wirksamkeit der Lithium-Therapie und zu deren neuroprotektiven und antisuizidalen Eigenschaften sind kürzlich veröffentlicht und diskutiert worden (Richardson T, Macaluso M, Expert Opin Drug Metab Toxicol 2017; 13:1105-1113).
12. LINKS und weitere Quellen: http://dgbs.de/service/ http://de.wikipedia.org/wiki/Lithiumtherapie
Allgemeine Übersicht, weitere Quellen Selbsthilfeforum der Dt. Gesellschaft für Bipolare Störungen: http://www.bipolar-forum.de/read.php?5,550265,550265#msg-550265 Narkose
, Schwangerschaft Niereninsuffizienz
mit Lithium weitere Infos als
RTF download
|
||